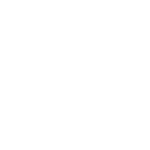1. Wie kann auf einen Umsatzeinbruch und eine Reduzierung der Liquidität im Unternehmen reagiert werden?
1.1 Wie kann ich schnell die Liquidität verbessern
Neben ersten Maßnahmen, wie Anträge auf Kurzarbeitergeld (siehe weitere Ausführungen), muss sehr engmaschig eine Liquiditätsplanung aufgestellt und angepasst werden.
Hierzu sollten sinnvollerweise Lastschrifteinzüge widerrufen werden, um über jede Auszahlung individuell entscheiden zu können. Stundungsvereinbarungen mit einzelnen Gläubigern sind eine der Möglichkeiten, fällige Verbindlichkeiten hinauszuschieben.
Des Weiteren sollte von den vom Gesetzgeber schon eingeführten erleichterten Regelungen zur Stundung von Steuerzahlungen gegenüber der Finanzverwaltung bzw. Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen gegenüber den jeweiligen Sozialversicherungsträgern Gebrauch gemacht werden. Wichtig ist, dass die Stundungsanträge vor Fälligkeit der jeweiligen Sozialversicherungsbeiträge etc. ausgebracht und idealerweise vorher entschieden werden. Die entsprechenden Arbeitsanweisungen in den Behörden lassen erkennen, dass Stundungsanträge, die im Ermessen der jeweiligen Behörde stehen, in dieser besonderen Krisensituation zugunsten des Unternehmens ausgelegt werden.
Im Steuerbereich betrifft das vor allen Dingen Umsatzsteuer und Körperschaftsteuer, bei Lohnsteuer ist vermutlich keine Stundung zu erwarten.
Anpassungen an die Steuervorauszahlungen sollten ebenfalls kurzfristig beantragt werden, da vermutlich auch die Gewinnsituation der jeweiligen Betriebe so oder so in diesem Jahr nach unten angepasst wird.
Versicherungsverträge sollen im Hinblick auf Betriebsunterbrechungsversicherungen überprüft werden.
1.2. Weitere Maßnahmen nach den Erstmaßnahmen zur Stabilisierung und Finanzierung des Geschäftsbetriebes
Vom Gesetzgeber sind vielfältige Maßnahmen angekündigt worden, wie z.B. zusätzliche Kredite, die über die jeweilige Hausbank durch staatliche Bürgschaften (z.B. durch die KfW; es gibt zusätzlich Landesprogramme) abgesichert werden.
Jedoch ist dabei zu beachten, dass das Kreditinstrument dazu führt, dass die Schuldenlast der jeweiligen Unternehmung steigt und Verbindlichkeiten - in welcher Form auch immer - in irgendeiner Weise später getilgt werden müssen. Hier sind allerdings die politischen Entscheidungen noch im Fluss. Vermehrt werden zu Recht Liquiditätsbeihilfen (nicht rückzahlbar) oder „BAföG-Modelle“ (Rückzahlung nach Leistungsfähigkeit) diskutiert.
1.3. Wie schnell ist mit der Auszahlung von Liquiditätshilfen zu rechnen?
Der Zeitraum ist derzeit schwer zu bestimmen. Grundsätzlich sind sämtliche Kredite bei der Hausbank zu beantragen, was voraussetzt, dass ein Unternehmen sich auch bislang über Banken finanziert hat. Sonst wäre ein schwieriger Erstkontakt herzustellen. Die Darlehensvergaben durch die Hausbanken dürfen dennoch nicht ohne Voraussetzungen erfolgen, auch wenn diese heruntergefahren sind. Diesbezüglich müssen die weiteren Informationen bei der Hausbank unter Beachtung der aufgelockerten Vorschriften zur Corona-Krise abgefragt werden. Üblicherweise sind es jedoch:
-
Jahresabschlüsse (möglichst aktuelle)
-
mindestens vollständige Betriebswirtschaftliche Auswertungen
-
Beschreibungen über die eingeleiteten und weiter vorgesehenen Maßnahmen sowie vor allen Dingen auch eine
-
Liquiditätsplanung für das Jahr 2020 und 2021.
Es wird darüber diskutiert, das Ausfallrisiko der Hausbanken, welches bislang bei 20 % liegt (80 % abgedeckt über die KfW oder andere regionale Förderbanken), abgesenkt wird. Aufgrund des Eigenrisikos, gerade auch in dieser besonderen Krisensituation, ist derzeit zweifelhaft, ob die Kreditinstitute zur erweiterten Kreditvergabe überhaupt bereit sind. Daher wird diskutiert, dass die Übernahme des Kreditrisikos seitens der KfW mit über 90 % angesetzt wird.
Ferner soll es ggf. möglich sein, Anträge direkt bei den Förderbanken zu stellen.
Es ist zu vermuten, dass die Auszahlung der staatlichen Hilfen längere Zeit in Anspruch nehmen wird.
Das gilt grundsätzlich auch für die andere Liquiditätshilfe in Form von Zuschüssen. Egal ob bei Krediten oder bei Zuschüssen, müssen die dafür erforderlichen Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht werden. Anderenfalls drohen strafrechtliche Risiken.
Es gibt mittlerweile verschiedene Soforthilfeprogramme, sowohl vom Bund, von den jeweiligen Bundesländern oder teilweise auch von Städten. Häufig ist jedoch den Programmen immanent, dass sie aufeinander aufbauen und keine Doppel- oder Mehrfachförderung vorsehen. Daher sind die verschiedenen Programme sehr sorgfältig zur Kenntnis zu nehmen.
Vom Land Niedersachsen ist nach derzeitigem Stand Folgendes in Form von 2 Richtlinien verabschiedet worden:
- Richtlinie „Corona-Soforthilfe für Kleinstunternehmen und Soloselbstständige“
Diese Förderung bezieht sich auf Soloselbstständige, freiberuflich Tätige und Kleinstunternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten. Diese können in 2 Stufen Zuschüsse bei Unternehmen bis 5 Beschäftigten in Höhe von bis zu 9.000,00 EUR bekommen. Bei Unternehmen bis 10 Beschäftigten beträgt die maximale Zuschusshöhe 15.000,00 EUR. Die Beträge können zur Deckung des betrieblichen Defizits, also der Differenz des negativen Ergebnisses der Einnahmen abzüglich der Ausgaben, herangezogen werden. Eine Inanspruchnahme persönlicher oder betrieblicher Rücklagen, also des Vermögens, ist dafür angabegemäß nicht notwendig, diese werden daher nicht angerechnet. - Richtlinie „Corona-Soforthilfe für Kleinunternehmen“
Die 2. Richtlinie richtet sich an Unternehmen und freiberuflich Tätige mit einem größeren Beschäftigungskreis ab 11 bis 49 Beschäftigte. Auch hier erfolgt die Förderung wie bei der 1. Richtlinie in 2 Stufen. Bei Unternehmen, die 11 bis 30 Beschäftigte haben, beträgt der maximale Förderungsbetrag 20.000,00 EUR. Für Unternehmen mit 31 bis 49 Beschäftigte beträgt der Zuschussbetrag 25.000,00 EUR.
Ansonsten sind weitere Regelungen in beiden Richtlinien vergleichbar. Jedoch ist zu beachten, dass die Förderung nicht die Lebenshaltungskosten abdecken soll. Hierfür müsste im Worst-Case-Fall Arbeitslosengeld II beantragt werden.
Anliegend Links zu folgenden Themen:
• Verwaltungsvereinbarung über die Soforthilfe des Bundes
• Vollzugshinweise des Bundes
• Pressemitteilung des Bundes
• Homepage der NBank: https://www.nbank.de/
2. Laut meiner Finanzplanung ist mein Unternehmen - verursacht durch die Corona-Krise - zahlungsunfähig. Was ist zu tun?
Grundsätzlich ist bei Zahlungsunfähigkeit ein Insolvenzantrag zu stellen. Die Nichtbeachtung hat für die Geschäftsführung strafrechtliche und zivilrechtliche Konsequenzen, die erheblich sein können. Bei Nichtabführung der Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung macht man sich strafbar (§ 266a StGB). Es soll jedoch Gesetzesänderungen geben, dass eine Insolvenzantragspflicht bis zum 30.09.2020 für das Unternehmen ausgesetzt wird. Ebenfalls dürfen Gläubiger (Stand des aktuellen Gesetzesentwurfs) bis zu 3 Monate lang - beginnend ab dem 01.04.2020 - keine Fremdanträge stellen, wenn der Insolvenzgrund erst nach dem 01.03.2020 eingetreten ist. Voraussetzungen für die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht sollen sein, dass
-
der Insolvenzgrund auf die Auswirkungen der Corona-Krise beruht,
-
aufgrund einer Beantragung öffentlicher Hilfen bzw. ernsthafter Finanzierungs- oder Sanierungsverhandlungen Aussicht auf eine Sanierung besteht.
Um eine Haftung zu reduzieren bzw. auszuschließen, müssen diese Voraussetzungen tatsächlich vorliegen, ggf. macht es Sinn, sich dieses durch einen Dritten, wie Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, bestätigen zu lassen. Es sollte ein neutraler Dritter eine Stellungnahme abgeben.
Nichts ändert dieses Gesetz allerdings an der faktischen Situation, dass ein Unternehmen vielleicht aus rechtlichen Gründen keinen Insolvenzantrag stellen muss und auch ein Gläubiger keinen Antrag stellen kann, aber dennoch stellen sollte. Dafür sprechen vor allem 2 Gründe:
Erstens muss davor gewarnt werden, nur abzuwarten, denn neben dem Ausschluss einiger strafrechtlicher Vorschriften bleibt es jedoch beim Eingehungsbetrug (§263 StGB) und anderer strafrechtlich relevanter Vorschriften (z.B. § 266 a StGB – Veruntreuung von Arbeitnehmerbeiträgen zur Sozialversicherung), die außerhalb der strafrechtlichen Insolvenzantragspflichtverletzung nicht ausgeschlossen worden sind. Auch sind die Ansprüche der Finanzverwaltung gem. §§ 34, 69 AO (persönliche Haftung der Unternehmensleitung) nicht ausgeschlossen worden.
Zweitens gibt das Insolvenzrecht vielfältige Sanierungsmöglichkeiten, wie die Finanzierung über Insolvenzgeld, das - anders als Kurzarbeitergeld - dem vollen Nettogehalt entspricht. Insoweit sollten sich Unternehmensleiter ernsthaft mit dem Gedanken einer Sanierung über das Insolvenzverfahren auseinandersetzen, denn auch später im Insolvenzverfahren gibt es die Möglichkeit, über Kurzarbeitergeld die Zeit des Insolvenzgeldzeitraums im Ergebnis zu verlängern. Beim Insolvenzgeld gibt es eine Beitragsbemessungsgrenze von derzeit 6.900,00 EUR in den sogenannten alten Bundesländern und 6.450,00 EUR Beitragsbemessungsgrenze in den neuen Bundesländern, die bei den Mitarbeitern in den wenigsten Fällen erreicht werden sollte.
Dabei ist wichtig zu betonen, dass die Einleitung eines Insolvenzverfahrens - je frühzeitiger dieses geschieht - selten das wirtschaftliche Ende eines Unternehmens bedeutet. Die Insolvenzordnung kennt vielfältige Sanierungsmöglichkeiten, um das Unternehmen auf gesunde Beine zu stellen. Die Statistiken besagen jedoch auch, dass je länger man wartet, die Quote erfolgreicher Sanierungen sinkt.
Die bisherigen Maßnahmen des Gesetzgebers greifen allerdings noch zu kurz und kommen zu spät, um den Unternehmen wirklich zu helfen, da sie auf Jahre hinaus durch hohe Kreditmittel den Unternehmen weitere Belastungen aufbürden, mit denen man später ggf. dann doch in die Insolvenz gehen muss.
Es sei dringend davor gewarnt, dass Unternehmen sich jetzt auf die Herausgabe der Darlehen verlassen, denn das kann ggf. nur zur Verschiebung und Vertiefung der Probleme führen. Denn ob Kredit, Bürgschaft oder Kurzarbeit, für eine Bearbeitung kann es sein, dass die personellen Kapazitäten fehlen und die Prozesse bis zur Zahlung - anders, als angekündigt - doch mehrere Wochen und Monate dauern und unter Umständen die Finanzliquidität den Unternehmen schneller ausgeht, als die Maßnahmen den Unternehmen helfen
3. Kurzarbeitergeld
Als eine der angekündigten Hilfen anlässlich der sog. Corona Krise hat die Bundesregierung die Regeln zum Kurzarbeitergeld modifiziert, was angabegemäß unbürokratisch beantragt werden könne. Voraussetzung hierfür ist nun, dass sowohl ein
-
Arbeits- als auch ein Entgeltausfall von mindestens 10 % vorliegen und
-
mindestens 10 % der im Betrieb oder in der Betriebsabteilung beschäftigten Arbeitnehmer von dem Arbeitsausfall betroffen sind.
Dabei kann der Arbeitsausfall auch vollständig, d.h. zu 100 % sein.
Das Kurzarbeitergeld beträgt für die ausgefallene Arbeitszeit 60 % (bzw. 67 % bei einem oder mehreren unterhaltspflichtigen Kindern) des pauschalen Nettoentgelts.
Wichtig ist vor allen Dingen, dass der Arbeitgeber das Kurzarbeitergeld nicht einseitig anordnen kann. Bei Bestehen eines Betriebsrats muss dieser zustimmen. Fehlt ein Betriebsrat, muss der jeweilige Arbeitnehmer individuell zustimmen.
Geringfügig Beschäftigte, die bspw. nicht mehr als 450,00 EUR brutto im Monat verdienen, haben keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld.
Arbeitszeitguthaben, die dem Arbeitnehmer zur freien Verfügbarkeit zustehen, müssen - anders als vor der Änderung - nicht abgebaut werden. Die Bundesagentur für Arbeit kann auf den Abbau von sogenannten Arbeitszeitkonten verweisen, wenn diese für die betriebliche Flexibilisierung der Arbeitszeit und nicht für andere Zwecke, insbesondere nicht für individuelle Zeiteinteilungen, zur Verfügung stehen. Arbeitszeitguthaben, die für die betriebliche Flexibilisierung verwendet werden, müssen derzeit nicht heruntergefahren werden.
Sozialversicherungsbeiträge, die vom Arbeitgeber auf das Kurzarbeitergeld zu zahlen wären, werden von der Arbeitsagentur erstattet. Auch Leiharbeitskräfte erhalten Kurzarbeitergeld.
Kurzarbeitergeld ist auch nicht lohnsteuerpflichtig, ähnlich wie Insolvenzausfallgeld. Es wird nur auf die Nettolohnersatzleistung abgestellt.
Alle Urlaubstage aus dem Jahr 2019 müssen vor Eintritt in die Kurzarbeit jedoch aufgebraucht werden. Das ist anders, als bei den Arbeitszeitguthaben.
Problematisch wird es sein, dass angesichts der Vielzahl der Anträge auf Kurzarbeitergeld, die bei den jeweiligen Arbeitsagenturen eingehen, damit zu rechnen ist, dass es mehrere Wochen dauern kann, bis es zur Erstattung kommt.
Wilhelm & Kollegen
Hohenzollernstr. 53
30161 Hannover